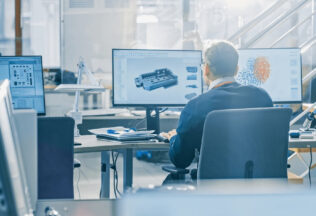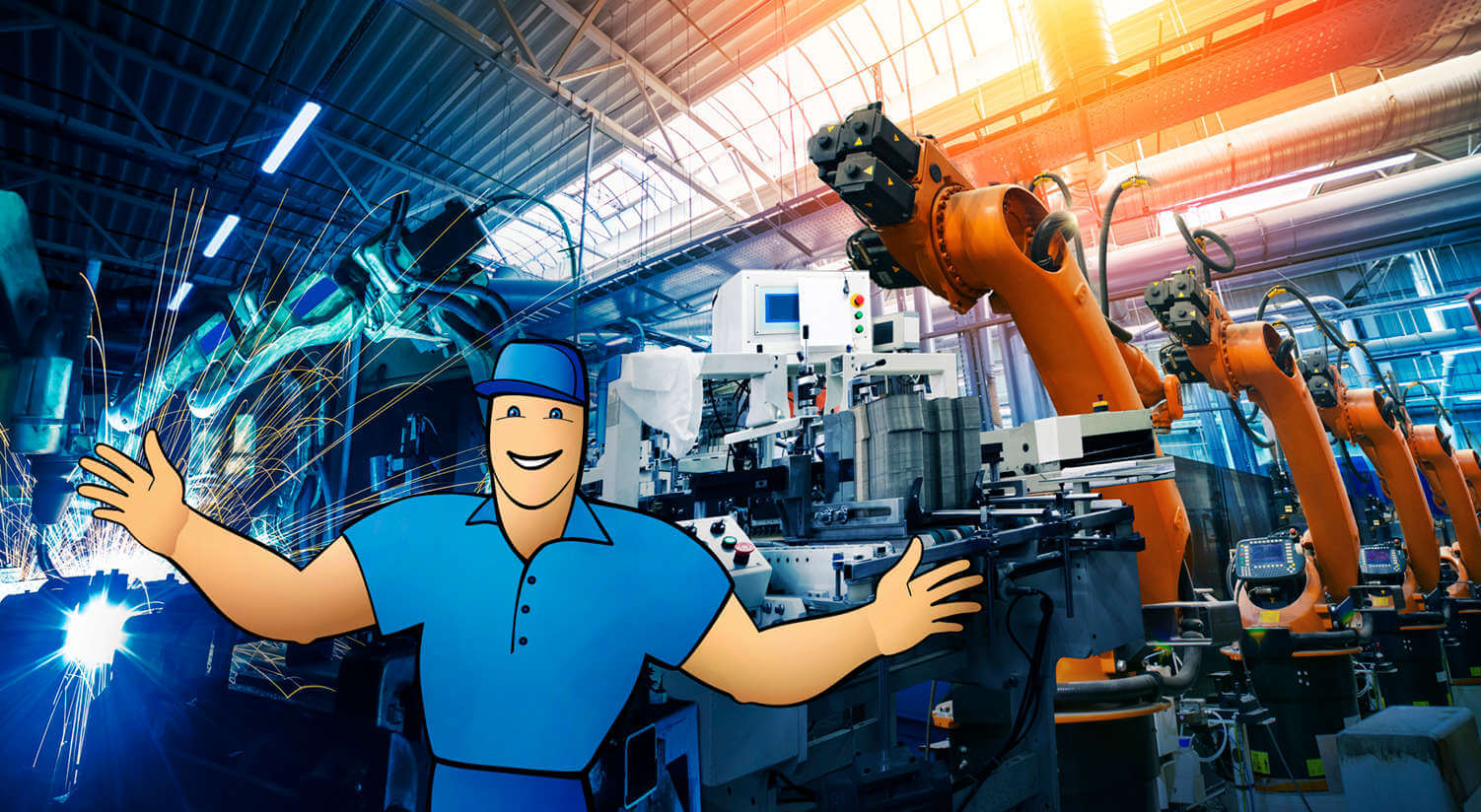Die 15 wichtigsten Kennzahlen für die Produktionsplanung in KMU
Die Produktionsplanung verbindet alle erforderlichen Aktivitäten für eine termingerechte und qualitativ hochwertige Produktion. Die Messung der Leistung dieser Aktivitäten unterstützt kleine Fertigungsunternehmen dabei, ihre betriebliche Effizienz zu verbessern und ihre Rentabilität sicherzustellen.

Was sind Kennzahlen für die Produktionsplanung?
Kennzahlen (oder Key Performance Indicators / KPIs) für die Produktionsplanung liefern umsetzbare Informationen über die Effizienz von Fertigungsprozessen im Zusammenhang mit der Planung und Terminierung. Die Produktionsplanung ist ein Teilbereich des Produktionsmanagements, der die Arten von erforderlichen Prozessen umfasst, um die termingerechte und effiziente Durchführung von Produktionsaktivitäten sicherzustellen. Dazu gehören beispielsweise Produktionsprognosen, Stücklistenverwaltung, Fertigungslayouts und -abläufe, Materialbedarfsplanung, Kapazitätsplanung und viele andere.
Das Verfolgen von Kennzahlen für die Produktionsplanung lässt Unternehmen die Produktionsleistung überwachen und Ineffizienzen identifizieren, um schnell auf Produktionsengpässe zu reagieren, übermäßige Ausfallzeiten zu vermeiden und Qualitätseinbußen zu erkennen. Eine konsequente Verfolgung liefert zusätzliche Erkenntnisse und deckt im Laufe der Zeit Trends und verborgene Muster auf. Insgesamt hilft die auf den verfolgten Kennzahlen basierende Produktionskontrolle den Managern, Ressourcen effektiver zuzuweisen und die Ergebnisse vorhersehbar und profitabel zu halten.
Kleine Unternehmen in der Fertigungsindustrie stehen vor einer besonderen Kombination von Herausforderungen. Angesichts begrenzter Arbeitskräfte, Materialien und Ausrüstung ist eine optimale Nutzung umso wichtiger. Das Verfolgen der richtigen Kennzahlen kann den Unterschied zwischen reaktivem Handeln und datengesteuertem Wirtschaften ausmachen.
Im Folgenden haben wir die wichtigsten Kennzahlen für die Produktionsplanung zur Skalierung von Fertigungs- und Vertriebsunternehmen zusammengestellt. Lassen Sie uns eintauchen.
Kennzahlen zur Produktionskapazität und Ressourcenauslastung
Ihre Fähigkeit, die verfügbaren Kapazitäten und Ressourcen effektiv zu nutzen, bildet die Grundlage für eine effiziente Produktion. Diese Kennzahlen verfolgen, wie gut Ihre Maschinen, Arbeitskräfte und Anlagen ausgelastet sind.
1. Kapazitätsauslastung
Die Kapazitätsauslastung misst den Prozentsatz der Produktionskapazität einer Produktionslinie oder Fertigungsstätte, der im Verhältnis zu ihrer maximalen potenziellen Leistung über einen bestimmten Zeitraum genutzt wird. Eine hohe Kapazitätsauslastung bedeutet einfach, dass Sie Ihre Anlagen optimal nutzen, während eine niedrige Auslastung auf eine Unterauslastung oder Überkapazitäten hindeutet.
Kapazitätsauslastung = (tatsächliche Leistung ÷ maximal mögliche Leistung) × 100
Beispiel: Angenommen, eine Fertigungsstätte für Unterbaugruppen kann bis zu 400 Baugruppen pro Tag verarbeiten, schafft aber nur 300. Ihre Kapazitätsauslastung beträgt daher 75 %.
Bedeutung für KMU: Dieser KPI lässt kleine Hersteller nachvollziehen, ob sie das Beste aus ihren vorhandenen Anlagen und ihrer Infrastruktur herausholen. Das Erkennen von nicht ausgelasteten Kapazitäten kann dazu beitragen, Strategien zur Steigerung der Nachfrage oder zur Optimierung der Produktionssteuerung zu entwickeln, um Leerlaufzeiten zu vermeiden. Es kann auch auf unnötige Investitionen in neue Anlagen hinweisen. Eine konstant hohe Auslastung (nahe 100 %) kann hingegen auf einen Erweiterungsbedarf hindeuten.
2. Maschinenauslastung
Die Maschinenauslastung ähnelt der Kapazitätsauslastung, ist jedoch maschinenspezifisch. Sie misst, wie oft eine bestimmte Maschine oder ein bestimmtes Gerät während seiner geplanten Betriebszeit aktiv genutzt wird. Sie konzentriert sich auf einzelne Anlagen und zeigt auf, wie diese zur Gesamteffizienz des Betriebs beitragen.
Maschinenauslastung = (Maschinenlaufzeit ÷ verfügbare Maschinenzeit) × 100
Beispiel: Wenn eine Maschine eine geplante Betriebszeit von 8 Stunden hat, aber aufgrund von Umrüstungen zwischen bestimmten Aufträgen nur 6 Stunden aktiv läuft, beträgt ihre Maschinenauslastung 75 %.
Bedeutung für KMU: Die Maschinenauslastung kann für KMU von entscheidender Bedeutung sein, da sie Ineffizienzen auf Maschinenebene aufzeigt. Niedrige Werte können auf eine Reihe von Problemen hinweisen, wie häufige Ausfälle, übermäßige Rüstzeiten, Materialmangel oder Nichtverfügbarkeit von Bedienpersonal. Nutzen Sie diese Daten, um Wartungspläne zu priorisieren, Umrüstverfahren zu optimieren oder den Materialfluss zu verbessern, um die Kapitalrendite zu steigern.
3. Durchsatz
Der Durchsatz ist die Rate, mit der fehlerfreie Einheiten durch einen Fertigungsprozess oder die gesamte Anlage über einen bestimmten Zeitraum produziert werden. Er ist ein direktes Maß für die Produktionskapazität des Fertigungssystems. In Verbindung mit Qualitätskontrollen ergibt diese Kennzahl die Erstausbeute, die wir weiter unten betrachten.
Durchsatz = Anzahl der produzierten einwandfreien Einheiten ÷ Zeitraum
Beispiel: Eine Arbeitsstation produziert innerhalb ihrer 8-stündigen Betriebszeit 300 akzeptable Einheiten. Der Durchsatz beträgt daher 300 geteilt durch 8 = 37,5 Einheiten/Stunde.
Bedeutung für KMU: Der Durchsatz ist eine direkte Produktivitätskennzahl, die einen schnellen Hinweis auf plötzliche Störungen in der Produktionslinie, wie z. B. Probleme mit der Materialverfügbarkeit, gibt, während eine langfristige Überwachung Engpässe und andere Effizienzverluste in Produktionslinien aufdecken kann. Umgekehrt ergibt sich daraus die Zeit, die zur Fertigstellung eines Artikels benötigt wird.
4. Produktionsausfallzeit
Die Produktionsausfallzeit bezieht sich auf die Gesamtzeit, in der eine Maschine, eine Produktionslinie oder ein Fertigungssystem über einen bestimmten Zeitraum nicht betriebsbereit ist. Ausfallzeiten können aus vielen Gründen auftreten, von Geräteausfällen bis hin zu Einrichtungsänderungen und Wartungsarbeiten. Sie werden entweder als geplant (z. B. geplante Wartungs- und Umrüstarbeiten) oder als ungeplant (z. B. Geräteausfälle, Materialengpässe usw.) klassifiziert.
Produktionsausfallzeit = Gesamtverfügbarkeitszeit – Gesamtbetriebszeit
Beispiel: Wenn eine Maschine für 10 Stunden Betrieb vorgesehen ist, aber 2 Stunden Ausfallzeit und 0,5 Stunden Rüstzeit hat, beträgt ihre Gesamtstillstandszeit für diesen Zeitraum 10 – (10 – 2 – 0,5) = 2,5 Stunden.
Bedeutung für KMU: Die Minimierung von Ausfallzeiten ist für kleinere Betriebe von entscheidender Bedeutung, insbesondere wenn sie ungeplant sind, da unerwartete Stillstände die Produktionssteuerung durcheinanderbringen, Lieferverpflichtungen gefährden und die Rentabilität beeinträchtigen. Das Verfolgen und Analysieren von Ausfallzeitdaten kann dabei helfen, die Ursachen für Produktionsunterbrechungen zu identifizieren, insbesondere wenn die Gründe für einzelne Vorfälle zusammen mit diesen erfasst werden, und vorbeugende Wartungsmaßnahmen besser umzusetzen, den MRO-Bestand (Maintenance, Repair, and Operations) zu optimieren oder die Schulung der Bediener zu verbessern, um zukünftige Störungen zu minimieren.
Kennzahlen für Planung und Prognose
Kennzahlen für Planung und Prognose geben Aufschluss darüber, wie gut die Produktionspläne mit der tatsächlichen Produktion übereinstimmen und wie genau die Nachfrage vorhergesagt wird. Ihr Verfolgen trägt zur termingerechten Erfüllung, zur Genauigkeit der Angebote und zur Ressourcenzuweisung bei.
5. Produktions- und Kundenvorlaufzeit
Die Vorlaufzeit ist eine wichtige Kennzahl für jeden Hersteller. Die Produktionsvorlaufzeit ist die Gesamtzeit, die ein Produkt vom Beginn des Produktionsprozesses (z. B. Ankunft der Rohstoffe oder Auftragseingang) bis zu seiner Fertigstellung und Versandbereitschaft benötigt. Die Kundenvorlaufzeit ist die Gesamtzeit vom Zeitpunkt der Auftragserteilung durch den Kunden bis zum Erhalt des fertigen Produkts. Dazu gehören die Auftragsabwicklung, die Produktion und die Lieferzeit.
Produktionsvorlaufzeit = Enddatum der Produktion – Startdatum der Produktion
Kundenvorlaufzeit = Lieferdatum – Bestelldatum
Beispiel: Wenn eine Bestellung am 1. Januar aufgegeben und am 15. Januar geliefert wird, beträgt die Kundenvorlaufzeit 14 Tage. Wenn die Produktion dieser Bestellung am 5. Januar begonnen und am 10. Januar abgeschlossen wurde, beträgt die Produktionsvorlaufzeit 5 Tage.
Bedeutung für KMU: Die Kenntnis Ihrer Produktionsvorlaufzeit ermöglicht eine genauere Angebotserstellung, und ihre konsequente Verfolgung kann dazu beitragen, Probleme zu erkennen, die die Produktionszeit verlängern, wie z. B. lange Warteschlangen, langsame Verarbeitungsschritte oder Materialverzögerungen.
Die Kundenvorlaufzeit zu verfolgen lohnt sich, da kürzere Werte sich direkt auf die Kundenzufriedenheit und die Reaktionsfähigkeit des Marktes auswirken. Sie kann das Vertrauen geben, dringendere Aufträge anzunehmen und effektiver mit größeren Unternehmen zu konkurrieren.
6. Prognosegenauigkeit
Prognosen messen, wie genau die tatsächliche Nachfrage oder Produktion mit der prognostizierten Nachfrage oder Produktionsmenge übereinstimmt. Mit anderen Worten: Diese Kennzahl bewertet die Zuverlässigkeit Ihrer Umsatz- und Produktionsprognosen.
Prognosegenauigkeit = (1 – |Prognose – Ist| ÷ Ist) × 100
Beispiel: Wenn Sie für April eine Produktion von 500 Einheiten prognostiziert haben, aber 520 produziert haben, beträgt Ihre Prognosegenauigkeit (1 – |500 – 520| ÷ 520) × 100 = 96,2 %.
Prognosefehler = |Istwert – Prognose| ÷ Istwert) × 100
Beispiel: Wenn Sie für April eine Produktion von 420 Einheiten prognostiziert haben, aber 400 Einheiten produziert wurden, beträgt Ihr Prognosefehler |400 – 420| ÷ 400 = 20 ÷ 400 = 5 %.
Darüber hinaus gibt es eine weitere gängige Methode zur Messung der Prognosegenauigkeit über längere Zeiträume, nämlich die Methode des mittleren absoluten prozentualen Fehlers (Mean Absolute Percentage Error oder MAPE). Dabei wird der Prognosefehler jedes Zeitraums als Prozentsatz der tatsächlichen Nachfrage ausgedrückt und dann über alle Zeiträume gemittelt, um eine Gesamtfehlerquote zu erhalten.
MAPE = (Σ |Istwert – Prognose| ÷ Istwert) ÷ n × 100 (wobei n die Anzahl der Perioden ist)
Beispiel: Wenn über drei Monate hinweg die tatsächliche Nachfrage 100, 150 und 200 Einheiten beträgt, während die Prognosen 110, 140 und 180, dann wäre die MAPE ((|100-110|/100 + |150-140|/150 + |200-180|/200) ÷ 3) × 100 = 8,9 %.
Bedeutung für KMU: Eine genaue Nachfrageprognose ist für eine optimale Produktionsplanung, Bestandsverwaltung und Ressourcenzuweisung von entscheidender Bedeutung, unabhängig davon, ob Sie auf Lager oder auf Bestellung produzieren. Eine unzureichende Prognose kann zu Überbeständen führen, die Kapital binden und zusätzliche Lagerkosten verursachen, oder zu Fehlmengen, die Umsatzverluste und Unzufriedenheit bei den Kunden zur Folge haben. Für kleinere Unternehmen mit begrenzten finanziellen Reserven ist die Minimierung dieser Risiken durch eine verbesserte Prognosegenauigkeit von entscheidender Bedeutung, um die Rentabilität aufrechtzuerhalten, Verschwendung zu vermeiden und die Beschaffung zu optimieren.
7. Fehlmengenquote
Die Fehlmengenquote misst, wie häufig es aufgrund unzureichender Lagerbestände zu Verzögerungen in der Produktion oder im Verkauf kommt. Sie spiegelt die Effektivität Ihrer Nachfrageplanung und Ihres Bestandsmanagements wider und sollte daher berücksichtigt werden.
Fehlmengenquote = (Anzahl der Fehlmengen ÷ Gesamtzahl der Kundenaufträge oder Produktionsläufe) × 100
Beispiel: Eine Holzwerkstatt stellt Bürostühle und Arbeitsplatten her. Aufgrund eines Lieferproblems wird der für die Detailarbeiten benötigte Lack nur alle zwei Wochen in kleinen Mengen geliefert, was zu wiederkehrenden Fehlmengen führt. Das Ergebnis sind 12 verspätete Bestellungen von insgesamt 180 Kundenaufträgen für das Quartal, was eine Fehlmengenquote von (12 ÷ 160) × 100 = 6,67 % ergibt.
Bedeutung für KMU: Eine niedrige Fehlmenge bedeutet einen vorhersehbaren Produktionsfluss und eine zuverlässige Lieferleistung. Eine gute Bestandskontrolle ist für kleine Unternehmen mit begrenztem Betriebskapital entscheidend – Sie müssen handeln, bevor Engpässe die Produktion oder Kundenverpflichtungen beeinträchtigen. Das Verfolgen der Fehlmenge lässt Sie Schwachstellen in der Nachfrageprognose, der Lieferantenzuverlässigkeit und der Materialplanung aufdecken.
Kostenbezogene Kennzahlen
Kostenkennzahlen stärken die Produktionsplanung, indem sie aufzeigen, wie effizient Ihre Ressourcen genutzt werden und wo in den Betriebsabläufen Geld verloren geht oder gewonnen wird.
8. Lagerumschlagshäufigkeit
Die Lagerumschlagshäufigkeit misst, wie oft Lagerbestände in einem bestimmten Zeitraum verkauft und ersetzt werden. Dies bietet Ihnen eine einfache, aber effektive Möglichkeit, die Effizienz des Lagerbestands im Verhältnis zum Umsatz zu quantifizieren. Eine höhere Quote deutet in der Regel darauf hin, dass weniger Kapital im Lagerbestand gebunden ist, während eine niedrige Quote auf eine schlechte Umsatzleistung oder Probleme bei der Lagerverwaltung hindeuten kann. Sie wird berechnet, indem einfach die Herstellungskosten durch den durchschnittlichen Lagerbestand eines Zeitraums dividiert werden.
Lagerumschlagshäufigkeit = Umsatzkosten ÷ durchschnittlicher Lagerwert
Beispiel: Unternehmen A verkauft im Laufe eines Jahres Waren im Wert von 500.000 Dollar, wobei der durchschnittliche Lagerwert bei 100.000 Dollar liegt. Damit beträgt die Lagerumschlagshäufigkeit 500.000 ÷ 100.000 = 5. Das bedeutet, dass der Lagerbestand im Laufe des Jahres fünfmal verkauft und wieder aufgefüllt wurde.
Bedeutung für KMU: Das Verfolgen der Lagerumschlagshäufigkeit lässt kleine Unternehmen ihren Cashflow ausgleichen, indem sie aufzeigt, ob die Lagerbestände mit der Produktion und dem Absatz übereinstimmen. Höhere Werte korrelieren in der Regel mit einer gesunden Finanzlage, jedoch ist es ratsam, Extreme auf beiden Seiten zu vermeiden. Eine sehr niedrige Lagerumschlagshäufigkeit ist ein zuverlässiger Indikator für Überbestände und Veralterungsrisiko, während eine sehr hohe Lagerumschlagshäufigkeit auf unzureichende Lagerbestände und ein entsprechendes Risiko von Fehlmengen hindeutet. Damit gehört die Umschlagshäufigkeit zu den effektivsten Kennzahlen, um sicherzustellen, dass Unternehmen über genügend Materialien zur Befriedigung der Nachfrage verfügen, ohne übermäßige Kosten zu verursachen.
9. Stückkosten
Die Stückkosten sind die Gesamtkosten, die für die Herstellung einer Einheit eines Produkts anfallen. Stellen Sie sich das als Durchsatz vor, jedoch in Euro. Die Kennzahl verwendet den KPI für die Gesamtherstellungskosten, sodass sowohl direkte (direkte Materialien, direkte Arbeitskosten) als auch indirekte Kosten (Fertigungsgemeinkosten) der Produktion berücksichtigt werden. Es handelt sich um einen grundlegenden KPI für die Preisgestaltung, die Rentabilitätsanalyse und die Kostenkontrolle.
Stückkosten = (Gesamtherstellungskosten ÷ Gesamtzahl der produzierten Einheiten)
Beispiel: Eine Papierfabrik berechnet ihre Gesamtherstellungskosten für das vergangene Jahr auf 1.500.000 Dollar, während sie 18.000 1-Tonnen-Papierrollen produzieren konnte. Damit betragen die Stückkosten 1.500.000 geteilt durch 18.000, also 83,33 Dollar.
Bedeutung für KMU: Die Stückkosten bieten eine einfache, aber genaue Grundlage für die Preisstrategie. Für kleine Hersteller können selbst geringfügige Kostenschwankungen erhebliche Auswirkungen auf die Margen haben, sodass das Verfolgen dieser Kennzahl dazu beiträgt, eine kontinuierliche Rentabilität sicherzustellen. Sie ist auch hilfreich, um Möglichkeiten zur Kostensenkung zu identifizieren, und dient als effektiver Maßstab für die Bewertung der Effizienz neuer Produktionsprozesse oder Lieferantenwechsel.
10. Ausschuss- und Nacharbeitskosten
Diese Qualitätskosten kennzeichnen die finanziellen Verluste, die durch fehlerhafte Produkte entstehen, die entweder entsorgt werden müssen (Ausschuss) oder zusätzliche Bearbeitung erfordern, um den Qualitätsstandards zu entsprechen (Nacharbeit). Diese Kosten umfassen Material, Arbeit und Gemeinkosten im Zusammenhang mit den verschwendeten oder korrigierten Artikeln. Zusammen spiegeln die Ausschuss- und Nacharbeitskosten die finanziellen Auswirkungen von Ineffizienzen bei Materialien, Arbeitsprozessen und Qualitätskontrolle wider.
Ausschusskosten = Anzahl der aussortierten Einheiten × Stückkosten (bis zum Ausschusspunkt)
Nacharbeitskosten = Anzahl der nachbearbeiteten Einheiten × Kosten für die Nacharbeit pro Einheit
Gesamtkosten für Ausschuss und Nacharbeit = Kosten für aussortierte Einheiten + Kosten für nachbearbeitete Einheiten
Beispiel: Fünf Einheiten einer eingehenden Lieferung von Baugruppen, die jeweils 50 US-Dollar kosten, fallen bei der Prüfung durch. Eine fehlerhafte Komponente entgeht der Qualitätskontrolle und landet in einem fertigen Produkt, was zusätzlich zum Austausch der fehlerhaften Komponente Nacharbeitskosten in Höhe von 250 € verursacht. Damit belaufen sich die Gesamtkosten für Ausschuss und Nacharbeit für den Auftrag auf (50 × 5) + 250, also 500 €.
Bedeutung für KMU: Ausschuss und Nacharbeit wirken sich auf die Rentabilität aus, da sie die Stückkosten erhöhen und Zeit und Material verschwenden. Das Verfolgen dieses KPI hilft dabei, bestimmte Produktionsstufen, Maschinen oder Prozesse zu identifizieren, in denen Fehler häufiger auftreten.
11. Kostenabweichung
Die Kostenabweichung ist die Differenz zwischen den Istkosten, die Ihnen durch eine Produktionsaktivität entstanden sind, und den budgetierten oder Standardkosten. Sie lässt Unternehmen Abweichungen von den geplanten Ausgaben identifizieren. Liegen die tatsächlichen Kosten unter den Standardkosten, wird die Kostenabweichung als günstig angesehen, und sie ist ungünstig, wenn die tatsächlichen Kosten die erwarteten Kosten übersteigen.
Kostenabweichung = Istkosten – Standardkosten
Beispiel: Eine Produktionsserie war mit 10.000 Dollar budgetiert, kostete aber letztendlich 11.500 Dollar. Die Kostenabweichung beträgt 1.500 Dollar, was ungünstig ist und 15 % über dem Budget liegt.
Bedeutung für KMU: Die Überwachung der Kostenabweichung ist für die Finanzkontrolle und Budgetierung ein wichtiger Faktor. Unerwartete Kostenüberschreitungen können die begrenzten finanziellen Reserven kleinerer Unternehmen erschöpfen. Die Kostenabweichung lässt Sie Probleme bei der Budgetierung aufzeigen, sodass Sie als Entscheidungsträger schnell auf steigende Ausgaben oder Prozessineffizienzen reagieren können.
Qualitätskennzahlen
Qualität ist ein weiterer wichtiger Bereich in der Fertigung, in dem das Verfolgen von Kennzahlen eine entscheidende Rolle spielt. Während die Qualitätssicherung eine eigene Disziplin ist, fließen viele qualitätsbezogene KPIs auch direkt in die Produktionsplanung und Prozessverbesserung ein.
12. First Pass Yield
First Pass Yield oder FPY misst den Prozentsatz der Einheiten, die korrekt produziert wurden und alle Qualitätsspezifikationen beim ersten Durchlaufen eines Produktionsprozesses oder eines bestimmten verfolgten Schritts erfüllen, ohne dass Nacharbeiten, Ausschuss oder erneute Tests erforderlich sind. Dieser KPI, der auch als Erstqualitätsrate bezeichnet wird, gibt direkt Auskunft über die Prozessqualität beim ersten Versuch.
First Pass Yield = (Einheiten, die die Qualitätsprüfung beim ersten Versuch bestehen ÷ Gesamtzahl der produzierten Einheiten) × 100
Beispiel: Der Produktionsprozess eines Elektronikmontageunternehmens erzeugt 60 komplette Leiterplatten in einer Chargenproduktion. 57 davon bestehen die Endkontrolle beim ersten Versuch, ohne dass Nacharbeit oder Reparaturen erforderlich sind. Die FPY beträgt (57 ÷ 60) × 100 = 95 %, was bedeutet, dass 5 % der Produktion zusätzliche Zeit und Ressourcen zur Korrektur erfordern.
Bedeutung für KMU: FPY ist ein weiterer absolut grundlegender KPI für kleine Hersteller, da die Minimierung von Ausschuss und die Maximierung des Durchsatzes bei gleichbleibender Qualität praktisch Voraussetzungen für den Erfolg sind, wenn mit begrenzten Ressourcen und Produktionskapazitäten jongliert werden muss. FPY trägt direkt zu niedrigeren Stückkosten und verbesserten Produktionsvorlaufzeiten bei, indem er hilft, redundante Arbeit zu vermeiden.
13. Ausschussquote
Die Ausschussquote ist eine Erweiterung des KPI „Fehlerquote“, der die Anzahl der Qualitätsprobleme in Produktionszyklen verfolgt. Die Ausschussquote verfolgt Einheiten in der Produktionsleistung, die nicht nur die Qualitätsstandards nicht erfüllen, sondern vollständig verschrottet werden müssen. Damit konzentriert sich die Ausschussquote weniger auf die Produktqualität als vielmehr auf die Prozessgenauigkeit, indem sie Verschwendung und Ineffizienz in den Produktionslinien aufzeigt.
Ausschussquote = (Anzahl der verschrotteten Einheiten ÷ Gesamtzahl der produzierten Einheiten) × 100
Beispiel: Eine Metallwerkstatt produziert 1.000 Halterungen in einer Charge, aber 30 davon werden bei der Inspektion als irreparabel verformt befunden. Die Ausschussquote beträgt daher (30 ÷ 1.000) × 100 = 3 %.
Bedeutung für KMU: Die Ausschussquote liefert wertvolle Erkenntnisse über Materialverschwendung und Prozessineffizienz. Für kleine Hersteller verbessert die Reduzierung des Ausschusses direkt die Rentabilität und die Ressourcennutzung. Das langfristige Verfolgen lässt Sie wiederkehrende Qualitätsprobleme identifizieren und notwendige Korrekturmaßnahmen ergreifen, wie z. B. die Verfeinerung von Prozessen, die Schulung von Bedienern oder die Neukalibrierung von Geräten, bevor neue Verluste entstehen.
14. Termintreue
Die Termintreue (On-Time Delivery Rate oder OTD) misst den Prozentsatz der Bestellungen, die zum vereinbarten oder geplanten Liefertermin an die Kunden geliefert werden. Mit anderen Worten: Sie misst die Lieferpünktlichkeit eines Herstellers und spiegelt demnach ebenfalls wider, wie effektiv Produktion, Produktionssteuerung und Logistik aufeinander abgestimmt sind, um die Verpflichtungen gegenüber den Kunden zu erfüllen.
Termintreue = (Anzahl der termingerecht gelieferten Bestellungen ÷ Gesamtzahl der gelieferten Bestellungen) × 100
Beispiel: Ein Lebensmittelverarbeitungsbetrieb versendet 100 Bestellungen in einem Monat, aber 13 davon kommen verspätet bei den Kunden an. Fünf davon sind aufgrund von Problemen im Lieferkettenmanagement verspätet, während acht aufgrund von Qualitätsproblemen zu spät fertiggestellt wurden. Daher beträgt die Liefertreue (87/100) × 100 = 87 %.
Pünktlichkeit ist einer der wichtigsten Faktoren, anhand derer Kunden die Fähigkeit eines Unternehmens beurteilen, ihre Anforderungen zu erfüllen. Für KMU ist die Einhaltung einer hohen Termintreue besonders wichtig, da jede Bestellung und jeder Kunde mehr Gewicht hat als bei größeren Unternehmen. Verzögerungen und die dadurch verursachte Unzufriedenheit führen zu Reputationsproblemen, dem Verlust von Stammkunden und sogar zu möglichen Strafklauseln in Verträgen.
15. Perfect Order Rate
Die Perfect Order Rate (Perfekte Bestellrate) rundet die Liste der Kennzahlen für die Produktionsplanung ab und misst den Prozentsatz der Aufträge, die perfekt an die Kunden geliefert werden, sprich pünktlich, vollständig (alle Artikel enthalten), korrekt (richtige Artikel und Mengen), unbeschädigt und mit den korrekten Unterlagen. Sie ist ein umfassender Maßstab für die Auftragsabwicklung und somit ein Indikator für die Qualität des Produktionsplanungsprozesses.
Die Perfect Order Rate kann auf zwei Arten gemessen werden – anhand einzelner Kennzahlen oder anhand der Anzahl:
- Perfect Order Rate = (Pünktliche Lieferung %) x (Vollständige Aufträge %) x (Unbeschädigte Aufträge %) x (Korrekte Dokumentation %) x 100
- Perfect Order Rate = (Anzahl fehlerfreier Aufträge ÷ Gesamtzahl der Aufträge) × 100
Beispiel 1: Wenn 95 % der Bestellungen pünktlich, 98 % vollständig, 99 % unbeschädigt und 97 % korrekt sind, beträgt die Perfect Order Rate 0,95 x 0,98 x 0,99 x 0,97 x 100 = 89,40 %.
Beispiel 2: Von den 43 Bestellungen, die eine Holzwerkstatt im letzten Quartal ausgeliefert hat, wurden 40 fehlerfrei geliefert, sodass die perfekte Bestellrate (40 ÷ 43) x 100 = 93,02 % beträgt.
Bedeutung für KMU: Die Perfect Order Rate ist ein ganzheitliches Maß für die gesamte Kundenerfahrung. Für kleinere Unternehmen ist die konsistente Lieferung fehlerfreier Bestellungen entscheidend für den Aufbau von Kundenbeziehungen und die Förderung von Wiederholungskäufen. Durch einen umfassenden Überblick über die gesamte Betriebsleistung aus Kundensicht ermöglicht die Perfect Order Rate kleinen Herstellern, systemische Probleme in ihren Fertigungsabläufen zu identifizieren und zu beheben.
Implementierung und Überwachung von Produktionskennzahlen
Die Messung von Leistungskennzahlen ist nur der Anfang. Erst das Handeln auf deren Grundlage macht den Unterschied. KMU wissen oft, was sie messen müssen, haben jedoch Schwierigkeiten, die gewonnenen Erkenntnisse in Maßnahmen umzusetzen. Hier finden Sie einen grundlegenden Rahmen, wie Sie Ihr KPI-Programm effektiv gestalten.
- Wählen Sie die richtigen Kennzahlen aus. Wenn Sie gerade erst mit dem Verfolgen von Leistung beginnen, ist es sinnvoller, einige wenige Dinge gut umzusetzen, als viele Dinge nur unzureichend. Wählen Sie nur Kennzahlen, die Ihre strategischen Ziele und die betriebliche Realität widerspiegeln – wenn Sie sich auf weniger, aber aussagekräftigere Kennzahlen konzentrieren, können Sie Trends schneller erkennen und tatsächlich darauf reagieren. Stellen Sie sich bei der Entscheidung für eine Kennzahl zwei Fragen: Entspricht sie den Zielen des Unternehmens, wie z. B. einer kürzeren Vorlaufzeit oder einer geringeren Ausschussquote? Und sind die Daten zuverlässig und leicht zugänglich? Ein guter KPI ist messbar, umsetzbar und klar mit den Geschäftsergebnissen verknüpft.
- Legen Sie eine Basislinie und realistische Ziele fest. Nachdem Sie die Kennzahlen ausgewählt haben, ermitteln Sie Ihre aktuelle Situation und legen Sie fest, wo Sie hin möchten. Ihre aktuelle Leistung ist eine Basislinie, beispielsweise liegt Ihre Maschinenauslastung bei 72 %. Setzen Sie sich realistische, messbare Ziele, wie beispielsweise das Erreichen von 80 % innerhalb von sechs Monaten. Das Ziel sollte ambitioniert, aber dennoch erreichbar sein – dies trägt dazu bei, die Dynamik aufrechtzuerhalten. Legen Sie außerdem logische Überprüfungsintervalle fest, beispielsweise einmal pro Woche oder Monat, und weisen Sie die Verantwortung für die Überwachung und Verbesserung zu. Ohne Verantwortlichkeiten wird die KPI-Initiative garantiert in kürzester Zeit in den Hintergrund geraten.
- Datenerfassung und -analyse. Erinnern Sie sich an die oben genannte Klausel zur Erreichbarkeit? Die Datenqualität bestimmt die KPI-Qualität. Die Datenerfassung sollte einfach und nach Möglichkeit automatisiert erfolgen. Wenn Sie beispielsweise Metriken direkt über Ihr bestehendes ERP- oder MRP-System abrufen, können Sie Fehler bei der Dateneingabe reduzieren und mit Echtzeit-Erkenntnissen arbeiten. Legen Sie klar fest, wie, wann und von wem Daten erfasst werden sollen, um Konsistenz und Relevanz sicherzustellen. Konzentrieren Sie sich nach der Erfassung auf Datentrends und -muster, nicht nur auf einzelne Ergebnisse – hinter Datenmustern verbergen sich oft viele Engpässe oder Ineffizienzen. Hier können Analyseintegrationen wie Microsoft BI oder eigenständige KPI-Software einen großen Unterschied machen.
- Ergreifen Sie Maßnahmen auf der Grundlage von Erkenntnissen. Kennzahlen sind nur dann von Bedeutung, wenn sie zu Maßnahmen führen. Wenn beispielsweise ein KPI eine Abweichung anzeigt, z. B. dass sich die Vorlaufzeit um 12 % erhöht hat, ermitteln Sie mithilfe einer Ursachenanalyse den Grund dafür, weisen Sie die Verantwortung für das Problem zu und priorisieren Sie dessen tatsächliche Behebung. Es ist wichtig, sich zunächst auf Probleme mit großer Auswirkung zu konzentrieren, insbesondere wenn Sie ein kleines Unternehmen sind. Wenn sich die Leistung verbessert, aktualisieren Sie Ihre Basiswerte und passen Sie Ihre Ziele an. Im Laufe der Zeit sollte sich die Verfolgung von KPI zu einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess entwickeln, bei dem die Daten Maßnahmen anregen, die wiederum zu Ergebnissen führen.
Vereinfachen Sie die Verfolgung von KPI mit Fertigungssoftware
Moderne Produktionsplanungssoftware bietet Echtzeit-Transparenz über den gesamten Produktionslebenszyklus hinweg, vom Verkauf und Einkauf über die Material- und Auftragsverfolgung bis hin zur Produktionssteuerung, Qualitätskontrolle und mehr. Im Gegensatz zu tabellenbasierten Arbeitsabläufen überwachen diese einheitlichen Systeme die Arbeitslasten und behalten die Leistung automatisch im Blick. Auf KMU ausgerichtete Lösungen verbinden Erschwinglichkeit, wesentliche Funktionen, Benutzerfreundlichkeit und einfache Implementierung.
Das integrierte ERP-System für die Fertigung MRPeasy bietet integrierte KPI-Dashboards und Berichte, mit denen sich die Produktionsleistung und Bestandskennzahlen visualisieren lassen. So können Manager wichtige Indikatoren wie Kapazitätsauslastung oder Vorlaufzeiten im Blick behalten und gleichzeitig strategische Geschäftsziele abwägen. MRPeasy lässt sich auch in das Drittanbieter-Analyse-Tool Microsoft BI integrieren, um datengestützte Entscheidungen und benutzerdefinierte KPI-Berichte zu verbessern.
Für wachsende Hersteller ist die Einführung einer solchen Software eine kostengünstige Möglichkeit, die Effizienz zu steigern und wettbewerbsfähig zu bleiben. Sie sorgt dafür, dass alle Beteiligten, vom Einkauf über die Produktion bis hin zum Lager und Vertrieb, auf dem gleichen Stand sind, lässt die Erwartungen der Kunden erfüllen, und schafft die Grundlage für eine Skalierung des Betriebs, ohne die Kontrolle über Qualität oder Kosten zu verlieren.
Die wichtigsten Kernpunkte
- Umsetzbare Kennzahlen für die Produktionsplanung zeigen, wie gut ein Fertigungsunternehmen seine Produktionssteuerung, Prognosen, Ressourcennutzung und Produktion verwaltet. Sie verfolgen die Effizienz der Produktionsplanungsprozesse.
- Zu den wichtigsten Kennzahlen für die Produktionsplanung gehören Maschinen- und Kapazitätsauslastung, Durchsatz, Produktions- und Kundenvorlaufzeit, Prognosegenauigkeit, Lagerumschlag, Termintreue und viele andere.
- Die Auswahl einer fokussierten Reihe von Kennzahlen führt zu besseren Ergebnissen als die Überwachung aller möglichen Kennzahlen. Durch die Festlegung klarer Basiswerte, realistischer Ziele und regelmäßiger Überprüfungsintervalle wird das Verfolgen von Kennzahlen zu einem praktischen Managementinstrument.
- Automatisierungs- und ERP-Systeme vereinfachen die Leistungsüberwachung, indem sie Daten zentralisieren und Echtzeit-Dashboards bereitstellen. Das minimiert den manuellen Aufwand, verbessert die Genauigkeit und stellt sicher, dass Entscheidungen auf aktuellen Informationen basieren.
- Der Zugriff auf Echtzeitdaten ermöglicht eine schnellere und sicherere Entscheidungsfindung. Manager können schnell auf sich ändernde Arbeitslasten, Nachfrageschwankungen oder Leistungseinbrüche reagieren, um die Produktion an den Kundenerwartungen auszurichten.
- Eine konsequente Kennzahl-Überwachung fördert eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung, da die im Laufe der Zeit gewonnenen Erkenntnisse zu intelligenteren Anpassungen, besserer Leistung und stetigem Wachstum führen.
Häufig gestellte Fragen
Zu den wichtigsten Kennzahlen für einen Produktionsleiter gehören Kapazitätsauslastung, Durchsatz, Termintreue, Stückkosten und First Pass Yield. Zusammen zeigen diese Kennzahlen, wie effizient Ressourcen genutzt werden, wie zuverlässig Zeitpläne eingehalten werden und wie konsequent Qualitätsziele erreicht werden.
Die Produktionsqualität lässt sich anhand von Kennzahlen wie First Pass Yield, Ausschussquote und Fehlerfreiheitsrate messen. Diese KPIs lassen Sie feststellen, wie viele Produkte beim ersten Versuch die Spezifikationen erfüllen, wie viel Material verschwendet wird und wie oft Kunden vollständige, fehlerfreie Bestellungen erhalten.
Beginnen Sie mit der Auswahl einiger wichtiger Kennzahlen, die Ihren Geschäftszielen entsprechen und für die Sie zuverlässig Daten sammeln können. Dazu gehören beispielsweise die Maschinenauslastung, die Stückkosten oder die Vorlaufzeit. Gehen Sie beim Verfolgen von Kennzahlen systematisch und konsequent vor und bemühen Sie sich, die Ergebnisse zu analysieren und auf der Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse Maßnahmen zu ergreifen. Erwägen Sie die Einführung einer Fertigungssoftware, die große Teile der Datenerfassung und Prozessverfolgung automatisiert.
Ihnen könnte ebenfalls gefallen: Die 11 wichtigsten KPIs für das Bestandsmanagement im Jahr 2025